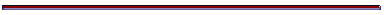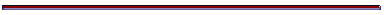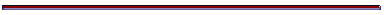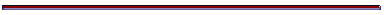Claudio Monteverdi (1567-1643):
"L'Orfeo. Favola in musica" (BBC/Opus Arte)
Furio Zanasi - Arianna Savall - Sara Mingardo - Montserrat Figueras -
Antonio Abete - Fulvio Bettini / La Capella Reial de Catalunya -
Les Concert des Nations - Ltg.: Jordi Savall
Regie: Gilbert Deflo / Produktion des Gran Theatro des Liceu,
Barcelona 2002
"Il Ritonro d'Ulisse in Patria. Drama per Musica" (Arthouse, Best. Nr. 100 353)
Vesselina Kasarova - Dietrich Henschel - Malin Hartelius -
Isabel Rey - Martina Jankovà - Cornelia Kallisch - Jonas Kaufmann -
Rudolf Schasching - Reinhard Mayr - Martin Zysset - Thomas Mohr -
Martin Orò - Pavel Daniluk - Giuseppe Scorsin - Anton Scharinger -
Boguslaw Bidzinski / ›Orchestra La Scintilla‹ des Opernhauses Zürich /
Ltg. Nikolaus Harnoncourt / Regie: Klaus-Michael Grüber / Produktion
des Opernhauses Zürich 2002
Avandgardistische Spätgeburt
Die Oper war das spätgeborene Kind der antikenbegeisterten Renaissance - und wurde schließlich zur musikalischen Avandgarde des Barockzeitalters. Als sich Ende des 16. Jahrhunderts in Florenz ein illustrer Kreis von Mäzenen, Musikern und Gelehrten versammelte, war das vorgebliche Ziel nichts weniger als die Wiederbelebung des antiken Theaters. Man wußte, dass die Rollen in den griechischen Tragödien nicht einfach gesprochen, sondern gesungen worden waren. Seit dem hohen Mittelalter war aber in der weltlichen und religiösen Kunstmusik die polyphone, mehrstimmige Musik das Maß der Dinge. Da bedurfte es schon eines traditionsmächtigeren Arguments, um der geradezu avandgardistischen Ästhetik der ›Florentiner Camerata‹ zum Durchbruch zu verhelfen. Erste Versuche mit der Monodie machten die Probe aufs Exempel: In radikaler Abkehr von der älteren Praxis gab es hier einen von wenigen Instrumenten wie Cembalo, Orgel, Harfe, Laute oder Cello begleiteten Sprechgesang zu hören, der die Musik bis
zur Selbstverleugnung dem Wort unterordnete.
Der Durchbruch: Monteverdis "Drama in Musik"
Mit Claudio Monteverdis ›L'Orfeo‹, 1607 im fürstlichen Palast von Mantua uraufgeführt, erlebte die noch junge Gattung dann ihren ersten Höhepunkt. Die Geschichte um den Halbgott Orpheus, der mit seinem überirdischen Gesang selbst wilde Tiere zu zähmen vermochte, war für eine ›Favola in Musica‹, eine ›Musikfabel‹ per se wie geschaffen.
Alessandro Striggio, Monteverdis Librettist, arrangierte die Motive der antiken Vorlage zu einem harmonischen Ganzen: Da gibt es das glückliche Brautpaar (Orpheus und Euridike), pastorales Idyll (Hirten und Nymphen), Schicksalschläge (Euridikes Tod) und heroische Rettungsversuche (Orpheus Abstieg in die Unterwelt), schließlich echte Tragik (Orpheus verstößt gegen göttliches Gebot und verliert Euridike für immer). Und zum Schluß gestattete Striggio seinem Publikum doch ein halbes Happy End, wenn der trauernde Orpheus von seinem Vater Apoll in den Himmel entrückt wird - eine Apotheose, die zugleich zum Anlass für das erste Duett der Operngeschichte wurde.
Monteverdis kongeniale Leistung bestand darin, den Akademismus seiner Vorgänger zu überwinden und die Musik wieder zu ihrem Recht kommen zu lassen: Sein ›L'Orfeo‹ kennt nicht nur den neuen monodischen Gesang, sondern bezieht auch das ältere mehrstimmige Madrigal (für die Chöre und Ensemble) und Instrumentalmusik in Gestalt zahlreicher Tänze und "Sinfonien" mit ein. Dank seiner musikdramatischen Einfühlung in das sensible Verhältnis von Wort, Szene, Aktion, Geste und Musik setzte der Komponist einen opernästhetischen Maßstab, der erst wieder im Opernschaffen Mozarts ein Äquivalent fand. Der Erfolg des ›L'Orfeo‹ hat der Oper im Barock zum Durchbruch verholfen. Sie wurde das zentrale musikalische Genre dieses theatralischen Zeitalters.
Dreißig Jahre später eröffnete in Venedig das erste öffentliche Opernhaus: San Cassino - kein repräsentatives Fürstentheater für erlesenes Pubklikum, sondern ein kommerzielles Unternehmen, das von Eintrittsgeldern lebte. Seit 1612 wirkte auch Monteverdi in Venedig als Kapellmeister an der Basilika San Marco; sein Amt im Dienste geistlicher Musik hinderte ihn nicht daran, weiter Opern zu komponieren. 1640 wurde erstmalig ›Il Ritorno d'Ulisses in Patria. Drama per Musica‹, die ›Heimkehr des Odysseus‹ gegeben. Aus der perfekt ausbalancierten Madrigaloper ›L'Orfeo‹ war ein sehr viel handfesteres Musiktheater geworden: lebensnahe Charakter, derbe Komik, skurrile Typen und sehr menschelnde Götter bevölkerten nun die Bühne. Tragik und Liebe sind jedoch die beherrschende Themen geblieben. Daneben wurden nun spektakuläre Verwandlungen der Szene und Spezialeffekte wie animierte Segelschiffe und Flugmaschinen aufgeboten, um das Publikum zu gewinnen. Und auch der Stil der Musik hatte sich
gewandelt: weniger Chöre und Instrumente, dafür mehr Ensemble, kurze liedhafte "Arien" und große, ausdrucksvolle Monologe. Die Sänger mußten zugleich gute Schauspieler sein. Monteverdis dramatisches Gespür zeigt in seiner Behandlung des eher mittelmäßigen Librettos vielleicht noch deutlicher als beim ›L'Orfeo‹. Und nirgendwo ist etwas von altersbedingten Ermüdungserscheinungen zu spüren.
Beide Opern sind soeben als Neuproduktionen auf DVD erschienen. Diese bringen nicht nur den so unterschiedlichen Charakter der beiden Werke exemplarisch heraus, sondern repräsentieren auch die Möglichkeiten einer zeitgemäßen Interpretation und Inszenierung.
Entrückt und lyrisch: "L'Orfeo"
Zusammen mit dem spanischen Dirigenten Jordi Savall beschwört der belgische Regisseur Gilbert Deflo in seiner Version des ›L'Orfeo‹ die Ästhetik einer (imaginären) historischen Uraufführung. Der große Spiegel, der bei Deflo den Bühnenvorhang ersetzt, ist hier, ähnlich wie in Lewis Carrols ›Alice hinter den Spiegeln‹, das magische Tor zu einer in Raum und Zeit entrückten Wunderwelt, in der Götter und Menschen in Musik und Dichtung "sprechen". Wenn es sich öffnet, schauen wir auf jenes idealisierte Arkadien, dem Monteverdi und Striggio in ihrer ›Favola‹ Gestalt verliehen haben.
Deflo wählt für die Verzauberung seines Publikums ein geradezu barockes Theaterszenario: Mit verschiebbaren, gestaffelten Kulissen schafft er einen verblüffenden Illusionsraum, der die Perspektive auf eine in gedämpft-goldenes Licht getauchte griechische Landschaft öffnet. Sänger und Sängerinnen treten in antikisierenden Kostümen des 17. Jahrhunderts auf, die anmutig-ornamentale Choreographie der Tänze erinnert an entsprechende Darstellungen auf Gemälden Raffaels. Bewegungen und Gestik vollziehen sich gemessen und stilisiert, mit größter Ruhe und Hingabe an den Augenblick. Glaubt man dem Regisseur, so sind Assoziationen an die "Zeitlupendramaturgie" des japanischen No-Theaters durchaus
gewollt. Die ganze Darbietung atmet den Geist eines herbstlichen Klassizismus: geschlossen, wohlproportioniert, durchgestaltet bis in das letzte Detail und damit ganz nah an Striggios sorgfältig komponierten Libretto.
Der szenischen entspricht die musikalische Seite: Sämtliche Musiker sind historisch kostümiert, Jordi Savall tritt gar im Gewande Monteverdis auf, dem er darin sogar entfernt ähnlich sieht. Musiziert wird mit konzentrierter Ruhe: zwar keinesfalls spannungsarm und undramatisch, doch eher lyrisch, fließend und mit wohlabgestimmten, ruhigen Tempi. Das homogene, volle Klangbild der Instrumente harmoniert vorzüglich mit der subtil ausgeleuchteten Koloristik des Bühnenbildes. Hier
gelingen Deflo und Savall die suggestivsten Momente. Das bis in die Nebenrollen erlesene Sängerensemble fügt sich ganz in diese Konzeption, von den vorzüglichen Einzelleistungen seien stellvertretend nur einige genannt: Furio Zanasi gibt den Titelhelden eher diskret, mit tenoralem Schmelz und virtuosen Reserven. Mit Arianna Savalls leuchtendem, mädchenhaften Sopran steht ihm eine anrührende Euridike zur Seite. Dramatisch am überzeugendsten agiert Sara Mingardo mit ihrem expressiven Alt in der Rolle der Unglücksbotin. Dagegen verleiht Antonio Abete dem unterweltlichen Fährmann Carron zwar übermenschliche Würde, gebietet aber nicht über jene vokale Bedrohlichkeit, um auch seiner "höllischen
Natur" angemessenen Ausdruck zu verleihen.
Orpheus Bitte an Carron, ihn über den Styx zu setzen - vielleicht läßt sich anhand der immerhin "spannendsten" Szene der Oper am besten zeigen, was dann insgesamt doch fehlt: Bei aller szenischen und musikalischen Schönheit wäre ein etwas kraftvollerer Zugriff und manchmal eine weniger artifizielle Ästhetik durchaus angebracht gewesen. Dieser ›L'Orfeo‹ hat etwas Gezirkeltes, Hermetisches an sich; seine Schönheit huldigt nicht nur von Ferne einem vergangenen Historismus. So weckt die Produktion Bewunderung für die starke künstlerische Gestaltungskraft von Regisseur und Dirigent, aber wenig Empfindung für die Schicksale der Personen. Um im Bild der Inszenierung zu bleiben: Deflos Spiegelvorhang ist nicht nur der Durchgang in eine andere Welt, er schafft auch eine gewisse Distanz, weil er den Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes auf sich selbst zurückwirft, statt ihn in das ästhetisch auf Distanz
gebrachte Geschehen hineinzuziehen.
Diesseitig und dramatisch: ›Ulisses‹
Einen ganz anderen Ansatz wählten dagegen Nikolaus Harnoncourt und Klaus-Michael Grüber für ihren Züricher ›Ulisses‹. Nach der schon legendären, opulent-barocken Inszenierung, mit der Jean Pierre Ponnelle das Werk (schon damals unter Harnonourts Dirigat) in den 70er Jahren am gleichen Haus weltberühmt gemacht hatte, geht Klaus-Michael Grüber nun den Weg in die Reduktion und Abstraktion. Mit diesem modernen Ansatz liegt er freilich auch konträr zur ausgefeilten Lukullik Deflos.
Der Raum wird von einer riesigen, drehbaren Plattform beherrscht, die mit ihrem weißen Kieselsteinbesatz je nachdem eine grüne Landschaft, eine felsige Küste oder den wolkigen Himmel markiert. Wechselnde, mit breitem Pinselstrich locker hingeworfener Prospekte, sparsame Kulissen und nur wenige Requisiten genügen, um jeder Szene ihr unverwechselbares Gesicht zu verleihen. Die einfachen, zeitlos-modernen Kostüme verweisen auf eine unbestimmte jüngere Vergangenheit irgendwo in Griechenland - doch spielt der genaue Zeitpunkt in dieser archaischen Welt, in der der Lauf der Dinge seinem eigenen Puls folgt, keine Rolle.
Grüber setzt nicht auf Maschinen- und Illusionseffekte, sondern auf das menschliche Drama und die so eminent theaterwirksame Musik Monteverdis. Nichts lenkt von der Handlung "in Musik" ab. Sängerinnen und Sänger müssen sich hier behaupten, indem sie als individuelle Personen agieren; auf stilisierte, stereotype Floskeln können sie nicht zurückgreifen. Dieses Konzept geht beeindruckend auf: Das Schicksal des seiner Heimat entfremdeten Odysseus und seiner Frau Penelope, die in Trauer und Entsagung regelrecht versteinert ist, wird ohne zeitgeistige Anbiederung und Überfrachtung mit großer Konsequenz gegenwärtig gesetzt. Selbst die obligatorischen Nebenhandlungen verselbständigen sich nicht, sondern erscheinen wie Ausleuchtungen des zentralen Geschehens aus einer
anderen Perspektive.
Dazu bietet Harnoncourt dank seiner phantasievollen Einrichtung der Partitur mit dem Züricher Orchester ›La Scintilla‹ ein ungemein farbenreiches, differenziertes Orchesterspiel. Plastischer als Savall konturiert er den musikalischen Satz heraus; so wirkt alles sehr gestisch, nervig, körperlich. Dass dabei die historischen Instrumente, insbesondere die Blechbläser, gelegentlich weniger sauber klingen als bei Savall, fällt kaum ins Gewicht.
Getragen wird die Aufführung nicht zuletzt von den hervorragenden Sängerdarsteller/innen (die manchmal über das Orchester hinwegsingen müssen): Dietrich Henschels mal kernig-sonorer, dann wieder sensibel deklamierender, spürbar im Liedgesang erfahrener Bariton siedelt seinen Odysseus auf der Grenze von barockem Heroen-Pathos und romantischer Tragik an. Daneben die herausragende Vesselina Kasarova mit faszinierend dunkler Tongebung - eine Stimme, die herbe Strenge mit vollendeter Rundung verbindet. Ihrer Peneolope, changierend zwischen sinnlicher Frau und personfizierter Keuschheit, sind die Lamenti Monteverdis wie auf den Leib komponiert. Penelopes unerwünschte, aber um so hartnäckigere Freier, adäquat verkörpert durch Martin Oró, Martin Zysset und Reinhard Mayr, werden unüberhörbar von Geldgier, Machismo und Lüsternheit getrieben. Grüber läßt sie auf einer mobilen Jahrmarktsbühne als vermeintlich harmlose Handpuppen agieren, die von ihren Sängern geführt werden - ein merkwürdiges
Spiel im Spiel nimmt da seinen Lauf, in dem Penelope zunächst immer härter bedrängt wird ... bis Odysseus dem ganzen Theater mit gezielten Bogenschüssen ein Ende macht. Als komplementäres zweites Paar Melanto und Eurimaco verbreiten Malin Hartelius und Boguslaw Bidzinski mit ihren jugendlichen Stimmen Sinnlichkeit und verspielte Erotik. Und auch der Humor kommt nicht zu kurz: Rudolf Schasching macht aus dem verfressenen Schmarotzer Iro, den Monteverdi mit einem grandiosen Monolog bedacht hat, einen tragikomischen, nichts desto trotz von feister Vitalität strotzenden Charakter. Sehr gut besetzt sind auch zahlreichen kleineren Rollen, so die Amme mit Cornelia Kallisch und die Göttin Minerva mit einer quicklebendigen Isabel Rey.
Empfehlenswert sind auf ihre Weise beide Produktionen, doch wird Monteverdis Modernität vor allem im vorzüglichen ›Ulisses‹ beeindruckend greifbar.
16 von 20 Punkte (L'Orfeo)
20 von 20 Punkte (Ulisses)
Georg Henkel